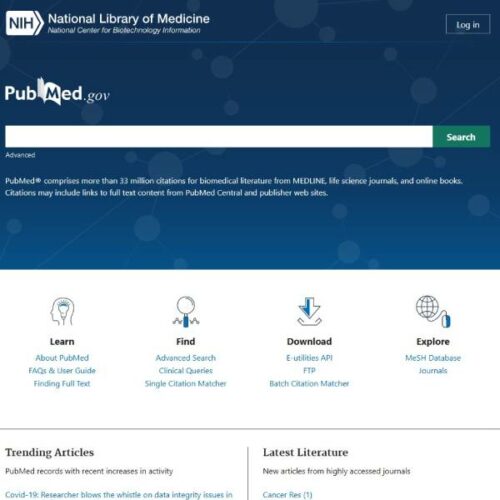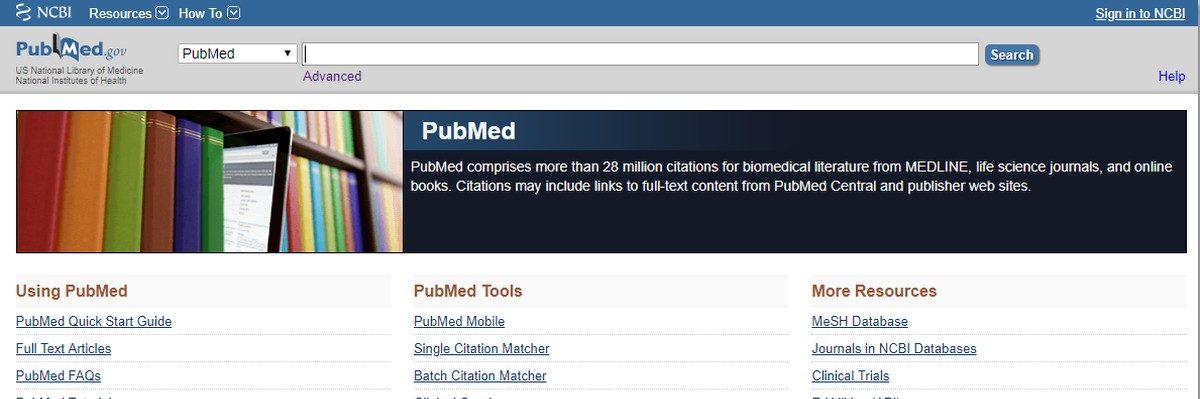Der Depression davonlaufen? – Die Bedeutung von Sport in der Therapie
Viele Menschen kennen das tolle Gefühl, das sich einstellt, wenn man sich gegen einen inneren Widerstand dazu aufgerafft hat, Sport zu treiben. Es ist nicht nur der Stolz darüber, den Schweinehund überlistet zu haben, der eine wohlige Zufriedenheit spüren lässt. Die positiven Gefühle, die bessere Stimmung und eine Beschwingtheit entstehen durch die Bewegung. Doch funktioniert das auch, wenn jemand nicht nur gerade keine Lust, sondern eine echte Depression hat? Wenn der Antrieb fehlt, man sich selbst gegenüber eine negative Wahrnehmung hat und auch der Blick nach vorne keine Besserung zu versprechen scheint?
Depressionen – jeder Fünfte erkrankt
Depressionen zählen zu den häufigsten und folgenreichsten psychischen Störungen. Gleichzeitig sind sie hinsichtlich ihrer Schwere die am meisten unterschätzten Erkrankungen. Das Risiko, im Laufe des Lebens eine Depression zu erleiden, liegt bei 16 bis 20 Prozent. Der Begriff »Depression« beschreibt ein klinisches Spektrum, das von einzelnen depressiven Symptomen über leichte oder unterschwellige Formen depressiver Störungen bis zu schweren depressiven Erkrankungen reicht. Besonders leichte Formen werden häufig übersehen oder nicht ausreichend und frühzeitig ernst genommen, obwohl auch sie oftmals bereits zu Beeinträchtigungen führen und vor allem mit einem erhöhten Risiko einhergehen, sich zu einer schwereren Form zu entwickeln.
Inzwischen sind einige biologische Faktoren bekannt, die bei der Entstehung eine Rolle spielen. Zum einen gibt es eine genetische Prädisposition, durch welche die Wahrscheinlichkeit, zu erkranken, auf bis zu 50 Prozent erhöht wird. Zum anderen weiß man, dass es ein Ungleichgewicht der Neurotransmitter gibt. Die Monoaminmangel-Hypothese geht von einer Verminderung der stimmungsaufhellenden Neurotransmitter Serotonin, Noradrenalin und Dopamin aus. Bekannt ist zudem, dass das cholinerge System, welches Acetylcholin als Transmitter nutzt, während einer Depression verstärkt aktiv ist. Weiterhin spielen strukturelle Veränderungen im Gehirn (u. a. eine gestörte Neurogenese) sowie Störungen der Hormonregulation (z. B. Kortison und Schilddrüsenhormone) eine Rolle.
Trotz des Zusammenspiels verschiedener organischer Systeme sind Depressionen gut zu behandelnde Erkrankungen. Neben einer medikamentösen Behandlung und Psychotherapie wird seit Jahren untersucht, welche Wirkung nichtmedikamentöse somatische Therapieformen haben. Dazu gehört unter anderem auch Sport und körperliche Aktivität. In vielen Studien zeigten sich sehr große Effekte auf die depressiven Symptome, die Ängstlichkeit, die Menge oder Dosierung an notwendigen Medikamenten. Auch die präventive Wirkung von Sport bestätigte sich.
Prof. Dr. Dr. Frank Schneider, Direktor der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik der RWTH Aachen, relativiert diese Aussagen allerdings: »Sport und körperliche Aktivität sind, wie die medikamentöse und psychotherapeutische Therapie, ein Aspekt in der Behandlung von Depressionen. Trotzdem ist es nicht so, dass Sport die anderen Therapien ersetzen könnte.« Zu diesem Ergebnis kommt auch ein Cochrane-Review (1), der randomisierte kontrollierte Studien analysierte, in denen körperliche Aktivität mit der Standardbehandlung, keiner oder einer Placebobehandlung, pharmakologischer oder psychotherapeutischer Behandlung oder einer anderen aktiven Therapieform verglichen wurde. Über 35 Studien hinweg ergab sich ein moderater klinischer Effekt, der sich weiter verringerte, wenn nur Studien höchster Qualität berücksichtigt wurden. Weder der direkte Vergleich von Bewegung mit einer pharmakologischen Behandlung noch der Vergleich mit psychotherapeutischer Behandlung brachte signifikante Unterschiede zutage. Allerdings wurden nur wenige kleine Studien herangezogen, so dass die Schlüsse nicht allgemeingültig sind.

Nächste Seite: Warum Sport gut tut | Depressionen im Leistungssport
Generell zeigt sich, dass es schwierig ist, Studien mit hoher Qualität, vergleichbaren Interventionen und einer ausreichenden Anzahl an vergleichbaren Teilnehmern durchzuführen. Das liegt einerseits daran, dass Verzerrungen nur schwer zu vermeiden sind. Allein die Verblindung ist schwierig und eine adäquate Kontrollgruppe bei körperlicher Bewegung oder einer Bewegungstherapie quasi unmöglich. Auch das Verhalten, das außerhalb der Intervention gelebt wird, ist schwer zu kontrollieren. Zudem wird die Bewertung der Therapie häufig über Selbstbeurteilungsbögen abgefragt, worin ebenfalls die Gefahr eines Bias liegt.
Doch trotz aller Schwierigkeiten in der objektiven Bewertung der Ergebnisse zeigen die vielen positiven Empfindungen der Studienteilnehmer, dass körperliche Aktivität gut angenommen wird und sich bei vielen Betroffenen die Lebensqualität verbessert. Auch in der »Nationalen Versorgungsleitlinie Unipolare Depression« wird allen Patienten mit einer depressiven Störung ein strukturiertes und supervidiertes körperliches Training empfohlen, sofern keine Kontraindikationen vorliegen.
Warum Sport gut tut
Sport bzw. körperliche Aktivität wirkt sich auf die Stimmung günstig aus, vermindert Angstgefühle und erhöht die Konzentration des Brain-derived neurotrophic factors (BDNF), der bei Depressiven verringert ist. Außerdem senkt er die Aktivität im präfrontalen Kortex, der bei Depressiven hyperaktiv und am endlosen Grübeln und negativen Emotionen beteiligt ist. Auf psychischer Ebene erhöht Sport die Selbstwirksamkeitserwartung und kann das Selbstwertgefühl verbessern. »Es ist nicht von Bedeutung, welcher Sport ausgeübt wird. Das Wichtigste ist, dass Sport getrieben wird und dass er positiv besetzt wird«, erklärt Prof. Schneider. Ein Einzelsport kann daher genauso sinnvoll sein wie Mannschaftssport, das Training im Fitnessstudio so effektiv wie ein Waldlauf. Jede Aktivität kann aber auch ungünstige Auswirkungen haben, beispielsweise wenn sich der Betroffene über- oder unterfordert fühlt, wenn das Training zu wenig Abwechslung bietet oder wenn die Ziele, die durch den Sport erreicht werden sollen, zu eng gesteckt sind.
Das zeigte die Auswertung des Berliner Sporttherapieprogramms zur Behandlung depressiver Störungen (2). Personen, die als einziges Ziel angaben, »das Laufen erlernen zu wollen«, empfanden bei einer Verletzung, die sie zwang zu pausieren, einen Misserfolg und die depressiven Symptome verschlechterten sich. Am meisten profitierten diejenigen, die zum Ziel hatten, »die psychischen Symptome zu verbessern«, am wenigsten diejenigen, die »Menschen kennenlernen« wollten.
Sehr wichtig ist aber die Frage, wie man Menschen, bei denen die Antriebsstörung ein zentraler Aspekt der Krankheit ist, dazu bringen soll, sich regelmäßig zu bewegen. Dazu muss sensibel für den Patienten das individuell passende Maß an körperlicher Aktivität gefunden werden. In Großbritannien wurde dafür der Physical Activity Facilitator (PAF) entwickelt. Im Zentrum steht die Beratung, um eine geeignete Sportart zu finden und die Steigerung der intrinsischen Motivation, damit diese aufgenommen und beibehalten wird.
Über die optimale Dauer und Intensität für die Behandlung der Depression kann noch keine wissenschaftlich begründete Aussage getroffen werden. Die NICE-Leitlinie »Depression« aus dem Jahr 2009 empfiehlt als Intervention für leichte bis mittelschwere Depressionen Bewegungsprogramme drei Mal pro Woche für die Dauer von je 45 bis 60 Minuten über 10 bis 14 Wochen.
Depressionen im Leistungssport
Dass eine hohe Intensität an sportlicher Aktivität nicht grundsätzlich vor psychischen Störungen schützt, wird spätestens dann sichtbar, wenn Leistungssportler an einem Übertrainingssyndrom leiden oder an einer Depression erkranken. Auch wenn sich in den letzten Jahren viel verbessert hat, um erkrankten Sportlern zu helfen, ist das Thema noch weitgehend tabu. Leistungssportler gelten nach außen hin als stark, motiviert und mental belastbar. Dass nicht nur eine Muskelfaser reißen kann, sondern auch die Psyche verletzlich ist, passt da nicht ins Bild. Zudem haben Sportmediziner, die von ihrer fachlichen Ausbildung in der Regel Internisten, Kardiologen oder Orthopäden sind, wenig Erfahrung mit psychiatrischen Krankheitsbildern.
Doch auch bei Sportpsychologen in Verbänden und Vereinen liegt der Fokus vor allem darauf, Sportlern mentale Hilfen an die Hand zu geben, um sportliche Höchstleistungen abrufen zu können. Leistungs- und Erfolgsdruck, Ausfälle durch Verletzungen, Existenz-ängste und finanzielle Sorgen sowie steigendes Alter und das nahende Karriereende können große Belastungen sein. Um Athleten schnell und kompetent helfen zu können, wurden sportpsychiatrisch-psychotherapeutische Sprechstunden an einigen Universitätskliniken eingerichtet, die sich auch mit der medikamentösen Therapie im Doping-Kontext auskennen.
Dass Sport vielfältige positive Wirkungen hat, ist weithin bekannt. Auch im Rahmen psychischer Erkrankungen sollte mehr Fokus darauf gelegt werden – nicht nur in der Therapie, sondern auch in der Prävention: Sport senkt unter anderem die Rezidivrate bei Depressionen.
Mehr Infos zum Thema: DGPPN – Referat Sportpsychiatrie und -psychotherapie
■ Hutterer C
Ähnliche Beiträge zum Thema finden Sie weiter unten!
Quellen:
Cooney GM, Dwan K, Greig CA, Lawlor DA, Rimer J, Waugh FR, McMurdo M, Mead GE. Exercise for depression. Cochrane Database Syst Rev. 2013; 9: CD004366. doi: 10.1002/14651858.CD004366.pub6
Erkelens M, Golz N. Effekte des Sporttreibens bei Depressionen: das Berliner Sporttherapieprogramm zur Behandlung depressiver Störungen – theoretische Grundlegung und Evaluation von Effektgrößen sowie Veränderungsursachen. Berlin: Köster Verlag; 1998.