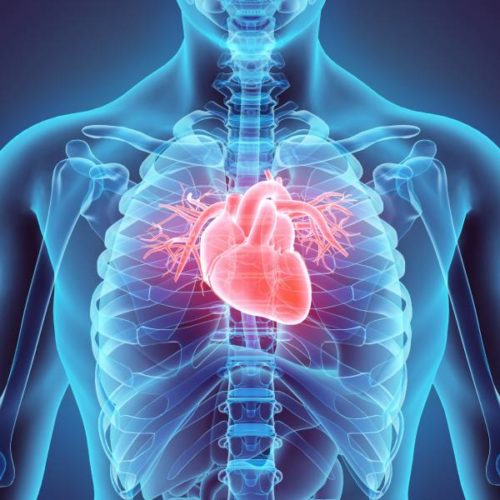Die Historie des Sportherzens
Prof. Wilfried Kindermann, Schriftleiter und Kardiologe, beleuchtet in seinem Editorial für die Jubiläumsausgabe 12/2019 der DZSM die Entdeckung des Sportherzens. Im Gegensatz zum krankhaft vergrößerten Herz ist das Sportlerherz ein physiologischer Anpassungsvorgang.
Der Münsteraner Sportmediziner Prof. Dr. Josef Schmidt schrieb 1974 in dieser Zeitschrift, damals noch „Sportarzt + Sportmedizin“, eine bemerkenswerte Eloge auf den schwedischen Arzt Henschen (22). Der Internist Prof. Salomon Eberhard Henschen, Direktor der Medizinischen Universitätsklinik in Uppsala und später am berühmten Karolinska-Institut in Stockholm tätig, stellte 1899 bei Skilangläufern mittels Perkussion (!) eine Herzvergrößerung fest, die er als Sportherz bezeichnete. Nicht nur die diagnostische Souveränität, sondern auch seine Schlussfolgerungen waren imponierend. Das bis zu jener Zeit generell als krankhaft stigmatisierte große Herz interpretierte Henschen als physiologischen Anpassungsvorgang, wenn es mit einer erhöhten Leistungsfähigkeit einhergeht, vorzugsweise verursacht durch umfangreiches Ausdauertraining.
Dennoch wurden in den folgenden Jahrzehnten Herzvergrößerungen bei Sportlern kontrovers diskutiert. Insbesondere Kliniker vermuteten eine myokardiale Schädigung, eine latente Herzinsuffizienz oder die Inanspruchnahme von Reservekräften des Herzens. Demgegenüber führte der Pathologe Linzbach den Begriff der physiologischen Herzhypertrophie ein und definierte ein kritisches Herzgewicht (14). Er postulierte, dass durch Sport vergrößerte Herzen ein Gewicht von 500g nicht überschreiten. Der Freiburger Kardiologe und Sportmediziner Reindell hat 1960 in seiner wegweisenden Monographie den damaligen Kenntnisstand dargestellt und durch zahlreiche eigene insbesondere röntgenologische und elektrokardiographische Studien ergänzt (17). Er gilt in Deutschland als Vater des Sportherzens.
In den folgenden Jahrzehnten wurde mittels Echokardiographie und weiterer bildgebender Verfahren das Sportherz als physiologischer Anpassungsvorgang bestätigt (7, 18, 21, 23). Zusammengefasst führt eine deutlich erhöhte sportbedingte Volumenbelastung zu einem physiologischen kardialen Remodeling. Die Muskelmasse des Herzens steigt an, alle Herzhöhlen vergrößern sich, es resultiert eine exzentrische Hypertrophie (5, 9, 11, 20). Bei afrikanischen/afrokaribischen Athleten ist die linksventrikuläre Hypertrophie ausgeprägter (3). Das Sportherz ist ein harmonisch vergrößertes Herz. Sportherzen können im Extremfall nahezu doppelt so groß wie normale Herzen werden. Andererseits führt nicht jeder Leistungssport zur Ausbildung eines Sportherzens, wenn der Umfang des Ausdauertrainings wie bei Kraft-und Schnellkraftsportarten limitiert ist. Sportherzen sind seltener als allgemein angenommen wird.
Während in der klinischen Kardiologie vorrangig die linksventrikuläre Muskelmasse bestimmt wird, ist in der Sportmedizin das Herzvolumen zur Beurteilung der trainingsbedingten Adaptation üblich. Seit den 1980iger Jahren hat die Echokardiographie die röntgenologische Herzgrößenbestimmung abgelöst und kann wegen der fehlenden Strahlenbelastung beliebig oft wiederholt werden. Beim gesunden Herz besteht eine hohe Übereinstimmung zwischen beiden Methoden (6). Das Herzvolumen korreliert zwar mit den Wettkampfleistungen in Ausdauersportarten, jedoch können im Einzelfall auch Sportler mit nur leicht vergrößertem Herz Spitzenleistungen erreichen oder Sportler mit sehr großem Herz sind nicht zwangsläufig im Wettkampf die Besten (8). Henschens Behauptung „Großes Herz gewinnt“ muss daher relativiert werden.

Gibt es ein Kraftsportherz? Morganroth et al. hatten 1975 bei Kugelstoßern und Ringern eine konzentrische linksventrikuläre Hypertrophie festgestellt und hypothetisiert, dass Ausdauer-und Kraftsport zu unterschiedlichen kardialen Adaptationen führen (15). Ursächlich wird die angestiegene Nachlast aufgrund des erhöhten Blutdrucks bei maximalen Kraftbelastungen angenommen. Inzwischen wird das dichotome Muster struktureller kardialer Adaptationen in Zweifel gezogen (25, 26). Die Kammerwände bei Kraftsportlern sind nicht dicker als bei Ausdauersportlern. Die relative Wanddicke, also die Relation aus Wanddicke und enddiastolischem Durchmesser des linken Ventrikels, zeigt keinen signifikanten Unterschied zwischen Untrainierten, Ausdauersportlern und Kraftsportlern (25). Ein häufig vernachlässigter Confounder ist ein eventueller Anabolikamissbrauch. Entweder erfolgten keine oder nur rudimentäre Angaben in den Studien. Anabol-androgene Steroide können eine linksventrikuläre Hypertrophie induzieren, häufig begleitet von einer gestörten diastolischen Funktion (24, 25). Verdickte Kammerwände bei normal großem oder eher kleinem linken Ventrikel beim Sportler sind verdächtig auf Anabolikamissbrauch, vorausgesetzt es besteht keine pathologische Druckbelastung oder hypertrophe
Kardiomyopathie.
Das Sportherz ist häufig von elektrokardiographischen Veränderungen begleitet. Die meisten wurden bereits 1960 von Reindell beschrieben (17): Sinusbradykardie, Sinusarrhythmie, ektoper Vorhofrhythmus, AV-Block 1. Grades, AV-Block 2. Grades (Typ Mobitz I), inkompletter Rechtsschenkelblock, erhöhte QRS-Voltagen. Sie sind auch in den neuesten internationalen Interpretationsempfehlungen des Sportler-EKG‘s als physiologische Veränderungen enthalten und bedürfen, wenn sie asymptomatisch sind, keiner weiteren Abklärung. Auch die frühe Repolarisation und konvexe ST-Strecken mit nachfolgend negativen T-Wellen in V1-V4 bei schwarzen Athleten werden als physiologisch beurteilt. Isoliert negative T-Wellen können in 2-4% zusammen mit einem Sportherz auftreten, sind aber abklärungsbedürftig, um eine strukturelle Herzerkrankung auszuschließen.
Seit der Jahrtausendwende werden mögliche kardiale Schäden durch umfangreichen und extremen Ausdauersport, also für die Entwicklung eines Sportherzens typische Belastungen, diskutiert. Umfangreiches Ausdauertraining über viele Jahre kann Vorhofflimmern bei männlichen Sportlern im mittleren und höheren Lebensalter begünstigen (1, 13). Jüngere Sportler haben demgegenüber kein erhöhtes Vorhofflimmerrisiko (16). Als ursächliche Mechanismen werden unter anderem der erhöhte parasympathische Tonus und die Vorhofvergrößerung diskutiert. Andererseits ist das atriale Remodeling Teil des Sportherzens.
Kontrovers diskutiert werden Funktion und Struktur des rechten Ventrikels bei Ausdauersportlern (4, 12). Nach erschöpfenden Ausdauerbelastungen wie Marathonlauf und Triathlon wird in einigen Studien über eine reversible rechtsventrikuläre Dysfunktion berichtet. Über eine mögliche Entwicklung einer arrhythmogenen rechtsventrikulären Kardiomyopathie durch jahrelanges umfangreiches Ausdauertraining wird spekuliert (12). Als wesentliche Ursache wird ein hoher Anstieg der nichtinvasiv gemessenen pulmonalarteriellen Drücke mit resultierendem hohen rechtsventrikulären Wandstress unter Belastung angenommen (12). Allerdings liegen die bei
Hochleistungssportlern unter maximaler Belastung mittels Swan-Ganz-Katheter gemessenen pulmonalarteriellen Drücke deutlich niedriger (10). Darüber hinaus wird vermutet, dass umfangreicher Ausdauersport myokardiale Fibrosen verursachen kann, da bei einzelnen Ausdauersportlern im Kardio-MRT ein Late Enhancement gefunden wurde (27). Letztlich sind die auf einzelnen Beobachtungsstudien basierenden Befunde nicht beweisend für eine sportbedingte Schädigung, da weitere Faktoren wie zwischenzeitliche Erkrankungen, insbesondere Myokarditis, oder der Missbrauch leistungssteigernder Substanzen berücksichtigt werden müssen.
Auch die insbesondere nach erschöpfenden Ausdauerbelastungen beobachteten passageren Anstiege der kardialen Marker Troponin I und T sowie BNP bzw. NT-proBNP haben zu Spekulationen über myokardiale Schäden geführt (19). In Ruhe sind die kardialen Marker bei Sportlern mit und ohne Sportherz nicht erhöht. Der belastungsinduzierte Anstieg der Troponine ist wahrscheinlich auf jenen Teil zurückzuführen, der im Zytosol der Kardiomyozyten lokalisiert ist, also nicht gebunden an die kontraktilen Proteine, so dass Zellnekrosen unwahrscheinlich sind. Andernfalls wäre schwer vorstellbar, dass ein Sportherz dauerhaft gesund bleiben kann. Der belastungsinduzierte Anstieg von BNP bzw. NT-proBNP ist vermutlich neben dem Anstieg der Katecholamine auf eine Zunahme des myokardialen Wandstress zurückzuführen.
In den letzten Jahren wurde in einigen Studien über vermehrten Koronarkalk bei Ausdauersportlern mittleren Alters berichtet. Andererseits hatten die meisten Sportler in diesen mittels Kardio-CT durchgeführten Studien normale Kalkscores (2). Atherosklerotische Plaques waren bei Sportlern mit hohem Trainingsumfang und langjährigem Ausdauertraining am häufigsten. Diese Sportler hatten besonders stabile Plaques, so dass ein geringeres Risiko für Rupturen anzunehmen ist. Als Mechanismen werden beispielsweise Scherkräfte bei gesteigertem koronaren Blutfluss während Belastung, Entzündungsreaktionen und freie Radikale diskutiert. Die Mortalität ist bei Sportlern mit hohem Trainingsumfang und Koronarkalk nicht erhöht.
Als Fazit kann festgestellt werden, dass das Sportherz ein physiologischer Anpassungsvorgang mit erhöhter Leistungsfähigkeit ist. Das Herz ist harmonisch vergrößert und exzentrisch hypertrophiert. Voraussetzung ist ein umfangreiches Ausdauertraining auf hohem Level. Eine konzentrische Hypertrophie, häufig als Kraftsportherz interpretiert, ist abklärungsbedürftig. Seit der ersten Beschreibung des Sportherzens 1899 werden mögliche Schäden diskutiert. In neueren Studien wird über eine mögliche rechtsventrikuläre Schädigung, myokardiale Fibrosen und vermehrten Koronarkalk bei einzelnen Ausdauersportlern berichtet. Für eine endgültige Beurteilung sind prospektive Längsschnittstudien notwendig. Gegen kardiale Schäden sprechen epidemiologische Studien, nach denen die Lebenserwartung von national und international erfolgreichen Ausdauersportlern nicht verkürzt sondern eher verlängert ist.
■ Kindermann W
Ähnliche Beiträge zum Thema finden Sie weiter unten!
Quellen:
Abdulla J, Nielsen JR. Is the risk of atrial fibrillation higher in athletes than in the general population? A systematic review and meta-analysis. Europace. 2009; 11: 1156-1159. doi:10.1093/europace/eup197
Baggish AL, Levine BD. Coronary artery calcification among endurance athletes: „Hearts of Stone. Circulation. 2017; 136: 149-151. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.117.028750
Basavarajaiah S, Boraita A, Whyte G, Wilson M, Carby L, Shah A, Sharma S. Ethnic differences in left ventricular remodeling in highly-trained athletes relevance to differentiating physiologic left ventricular hypertrophy from hypertrophic cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol. 2008; 51: 2256-2262. doi:10.1016/j.jacc.2007.12.061
Bohm P, Schneider G, Linneweber L, Rentzsch A, Krämer N, Abdul-Khaliq H, Kindermann W, Meyer T, Scharhag J. Right and left ventricular function and mass in male elite master athletes: a controlled contrast-enhanced cardiovascular magnetic resonance study. Circulation. 2016; 133: 1927-1935. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.115.020975
Dickhuth HH, Nause A, Staiger J, Bonzel T, Keul J. Two-dimensional echocardiographic measurements of left ventricular volume and stroke volume of endurance-trained athletes and untrained subjects. Int J Sports Med. 1983; 4: 21-26. doi:10.1055/s-2008-1026011
Dickhuth HH, Urhausen A, Huonker M, Heitkamp H, Kindermann W, Simon G, Keul J. Die echokardiographische Herzgrößenbestimmung im Sport. Dtsch Z Sportmed. 1990; 41: 4-12.
Hollmann W, Rost R. Funktion und Leistungsgrenzen des menschlichen Herzens. Dtsch Z Sportmed. 1987; 38: 231-242.
Keul J, Lehmann M, Dickhuth HH, Berg A. Vergleiche von Herzvolumen, nomographisch ermittelter Sauerstoffaufnahme und Wettkampfleistung bei Ausdauersportarten. Dtsch Z Sportmed. 1980; 31: 148-154.
Kindermann W. Das Sportherz. Dtsch Z Sportmed. 2000; 51: 307-308.
Kindermann W, Keul J, Reindell H. Grundlagen zur Bewertung leistungsphysiologischer Anpassungsprozesse. Dtsch Med Wochenschr. 1974; 99: 1372-1379. doi:10.1055/s-0028-1107950
Kindermann W, Scharhag J. The physiological hypertrophy of the heart. Dtsch Z Sportmed. 2014; 65: 327-332. doi:10.5960/dzsm.2014.154
La Gerche A, Burns AT, Mooney DJ, Inder WJ, Taylor AJ, Bogaert J, Macisaac AI, Heidbüchel H, Prior DL. Exercise-induced right ventricular dysfunction and structural remodelling in endurance athletes. Eur Heart J. 2012; 33: 998-1006. doi:10.1093/eurheartj/ehr397
Laszlo R, Steinacker JM. Competitive sports and atrial fibrillation. Dtsch Z Sportmed. 2016; 67: 237-243. doi:10.5960/dzsm.2016.243
Linzbach A. Herzhypertrophie und kritisches Herzgewicht. Klin Wochenschr. 1948; 26: 459-463. https://link.springer.com/article/10.1007%2FBF01480968
Morganroth J, Maron BJ, Henry WL, Epstein SE. Comparative left ventricular dimensions in trained athletes. Ann Intern Med. 1975; 82: 521-524. doi:10.7326/0003-4819-82-4-521
elliccia A, Maron BJ, Di Paolo FM, Biffi A, Quattrini FM, Pisicchio C, Roselli A, Caselli S, Culasso F. Prevalence and clinical significance of left atrial remodeling in competitive athletes. J Am Coll Cardiol. 2005; 46: 690-696. doi:10.1016/j.jacc.2005.04.052
Reindell H. Herz, Kreislaufkrankheiten und Sport. Johann Ambrosius Barth Verlag, München, 1960.
Rost R, Hollmann W, Gerhardus H, Philippi H. Die Anwendung der Echokardiographie in der Sportmedizin. Dtsch Z Sportmed. 1977; 28: 103-113.
Scharhag J, George K, Shave R, Urhausen A, Kindermann W. Exercise-associated increases in cardiac biomarkers. Med Sci Sports Exerc. 2008; 40: 1408-1415. doi:10.1249/MSS.0b013e318172cf22
Scharhag J, Löllgen H, Kindermann W. Competitive sports and the heart: benefit or risk? Dtsch Arztebl Int. 2013; 110: 14-23.
Scharhag J, Schneider G, Urhausen A, Rochette V, Kramann B, Kindermann W. Athlete’s heart: right and left ventricular mass and function in male endurance athletes and untrained individuals determined by magnetic resonance imaging. J Am Coll Cardiol. 2002; 40: 1856-1863. doi:10.1016/S0735-1097(02)02478-6
Schmidt J. 75 Jahre Sportherz. Spotarzt + Sportmed. 1974; 25: 225-229.
Urhausen A. Die Echokardiographie in der Sportmedizin Dtsch Z Sportmed. 2013; 64: 357-361. doi:10.5960/dzsm.2013.101
Urhausen A, Hölpes R, Kindermann W. One- and two-dimensional echocardiography in bodybuilders using anabolic steroids. Eur J Appl Physiol Occup Physiol. 1989; 58: 633-640. doi:10.1007/BF00418510
Urhausen A, Kindermann W. Sports-specific adaptations and differentiation of the athlete’s heart. Sports Med. 1999; 28: 237-244. doi:10.2165/00007256-199928040-00002
Utomi V, Oxborough D, Ashley E, Lord R, Fletcher S, Stembridge M, Shave R, Hoffman MD, Whyte G, Somauroo J, Sharma S, George K. Predominance of normal left ventricular geometry in the male ‘athlete’s heart’. Heart. 2014; 100: 1264-1271. doi:10.1136/heartjnl-2014-305904
van de Schoor FR, Aengevaeren VL, Hopman MT, Oxborough DL, George KP, Thompson PD, Eijsvogels TM. Myocardial fibrosis in athletes. Mayo Clin Proc. 2016; 91: 1617-1631. doi:10.1016/j.mayocp.2016.07.012